Die Energiewende ist in vollem Gange, und Energieversorgungsunternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre Geschäftsmodelle nachhaltig zu gestalten.
Angesichts des Klimawandels und wachsender gesellschaftlicher Erwartungen wird Nachhaltigkeit zum entscheidenden Faktor für den Erfolg der Branche. In diesem Beitrag werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Aktivitäten der Energieversorger im Wandel, um nachhaltige Strategien zu entwickeln, umzusetzen und ihren Erfolg zu evaluieren.
Trends und Strategien der Energieversorger
Der hohe Nachhaltigkeitsdruck bei Energieversorgungsunternehmen (EVUs) resultiert aus ihrer zentralen Rolle im Klimaschutz und der Energiewende. Mehr als 40 % der globalen CO2-Emissionen stammen aus diesem Sektor. EVUs stehen im Spannungsfeld zwischen ökologischen Herausforderungen, regulatorischen Anforderungen, wirtschaftlichen Zwängen und gesellschaftlichen Erwartungen. Unternehmen, die frühzeitig auf nachhaltige Strategien setzen, können langfristig Wettbewerbsvorteile sichern und ihre gesellschaftliche Akzeptanz stärken.
Wo stehen die EVUs bei diesem notwendigen Wandel?
Wie strategisch konsistent ist ihr Vorgehen? Folgen sie einem Masterplan?
Kommen Sie hinsichtlich E, S und G voran?
Steigen wir ein.
Strategische Analyse inkl. doppelte Wesentlichkeit
Inhaltlich geht es um
- eine strategische Analyse: SWOT- und PESTEL-Analyse in Bezug auf aktuelle Nachhaltigkeitsleistung (z. B. CO2-Bilanz, Ressourceneffizienz, soziale Verantwortung), existierende Nachhaltigkeitsziele und -maßnahmen. Risikobewertung, sowie Identifikation von Innovationspotenzialen und Marktchancen.
- das Unternehmensumfeld: Stakeholder-Analyse, Analyse aktueller und zukünftiger gesetzlicher Anforderungen (z. B. EU-Taxonomie, LkSG), Berücksichtigung globaler Standards und Initiativen (z. B. SDGs, GRI, SASB), Bewertung von Trends und Entwicklungen im Bereich nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen, sowie Identifikation von Wettbewerbern und deren Nachhaltigkeitsstrategien und Positionierung des eigenen Unternehmens im Nachhaltigkeitskontext.
- Wesentlichkeit: Systematische Erfassung von Nachhaltigkeitsthemen im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse, Ermittlung der Finanziellen und der Impact Wesentlichkeit, Priorisierung von Themen, sowie Verankerung wesentlicher Themen in der Unternehmensstrategie.
Diese drei Bereiche bilden die Grundlage für eine effektive und glaubwürdige Nachhaltigkeitsberichterstattung. Sie helfen Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsstrategien gezielt zu entwickeln und die Fortschritte transparent zu kommunizieren.
Praxisbeispiele:
- EnBW integriert seit 2014 die Nachhaltigkeitsberichterstattung in ihren Geschäftsbericht und plant mit „EnBW 2025“ den Weg zum nachhaltigen und innovativen Infrastrukturpartner. Auf Basis differenzierter Marktanalysen und unter Einsatz von Portfolioanalyse und Szenarioanalyse hat die EnBW zwei strategische Stoßrichtungen erarbeitet. Die Wesentlichkeitsanalyse stellt sicher, dass alle daraus abgeleiteten Schwerpunktthemen im integrierten Geschäftsbericht enthalten sind. Die Initiative „Next Level EnBW“ soll die Geschwindigkeit des Wandels erhöhen und die Innovationskraft fördern.
- RWE hat Nachhaltigkeit als Kernelement der Unternehmenskultur verankert. Es wurden neun prioritäre Handlungsfelder definiert; darunter Klimawandel, Biodiversität, Kreislaufwirtschaft, Vielfalt und Gesundheit & Arbeitssicherheit. Diese Handlungsfelder werden in den Nachhaltigkeitsberichten aufgegriffen und bewertet. RWE strebt Klimaneutralität bis 2040 an. Dazu investiert das Unternehmen in den Ausbau erneuerbarer Energien, Speichertechnologien und flexible Back-up-Kapazitäten sowie in die Wasserstoffproduktion.
Strategieentwicklung und Operationalisierung in Ziele und Maßnahmen
Inhaltlich geht es um
- eine Nachhaltigkeitsstrategie: Zentrale Handlungsfelder zur Erreichung der Vision, um ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit zu fördern. Dazu gehören Ziele, Schlüsselbereiche wie Klimaschutz, Ressourcenschonung, soziale Verantwortung, und gute Unternehmensführung.
- Ziele: SMART-Ziele dienen dazu festzulegen, welche Ergebnisse durch die Umsetzung von Maßnahmen erreicht werden sollen. Beispiele: klimaneutral bis 2025 bzw. 2030 (für Scope-1- und Scope-2-CO2-Emissionen), jährliche Reduzierung der Scope-3-CO2-Emissionen um 2,5 %, klimapositiv bis 2040, Recyclingquote bei Reststoffen bis 2030 auf mindestens 70 % erhöhen.
- abgeleitete Maßnahmen: Unternehmen ergreifen Maßnahmen, um die definierten Ziele zu erreichen. Beispiele: Reduzierung von CO2-Emissionen, Initiativen zur Minimierung des Ressourcenverbrauchs und zur Förderung der Kreislaufwirtschaft, Programme zur Förderung von DEI und Verbesserung der Arbeitsbedingungen, sowie transparente Berichterstattung.
Diese Inhalte zeigen, wie eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie gestaltet ist und welche Ziele und Maßnahmen daraus abgeleitet werden, um einen positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten.
Praxisbeispiele:
- EnBW plant, neben dem bereits genannten Fokus auf den Ausbau erneuerbarer Energien, den Kohleeinsatz bis 2028 zu beenden. Strategie, Ziele und Maßnahmen werden im Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht integriert berichtet.
- RWE entwickelt sich entlang von neun Handlungsfeldern von einem traditionellen Energieversorger zu einem führenden Anbieter erneuerbarer Energien. Das Unternehmen betreibt Windparks, Solaranlagen und Batteriespeicher in vielen Ländern, wobei der Großteil des Kerngeschäfts mittlerweile auf grüner Elektrizität basiert.
Auch EVUs wie E.ON, ENTEGA, MVV Energie, Vattenfall, Axpo Holding, Alpiq Holding und BKW Energie legen in ihren Berichten Wert auf die Integration von Nachhaltigkeitszielen in ihre Geschäftsstrategie und berichten über Maßnahmen zur Erreichung ihrer Ziele. I.d.R. geht es dabei um den Ausbau erneuerbarer Energien und die Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Einige Unternehmen berichten darüber hinaus über ihre Bemühungen im sozialen Bereich.
Laut der Studie „Digital@EVU 2023“ haben über 60 % der EVUs eine Digitalstrategie entwickelt, wobei die Digitalisierung als zentrale Voraussetzung gesehen wird, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
Strategieumsetzung und Projektmanagement
Hierzu verweise ich zunächst auf zwei Beiträge aus dem Jahr 2020:
- Praxisleitfaden zur Strategieimplementierung: prozessuale und strukturelle Verankerung, sowie inhaltliche Schwerpunkte der Strategieimplementierung, sowie
- Strategieimplementierung mit der BSC und …? – Hoshin-Kanri: Gewinnung neuer Umsetzungskraft, Zielkaskadierung und -dokumentation, vertikale und horizontale Anpassung.
Inhaltlich geht es beim Projektmanagement von Nachhaltigkeitsinitiativen um den Zeit- und Ressourcenplan, Schulungen und Workshops, Informationskampagnen, prozessuale Anpassungen, sowie kontinuierliche Verbesserungen entlang strategierelevanter Berichts- und Steuerungssysteme wie z.B. einer Sustainability BSC.
Praxisbeispiele:
- E.ON bietet ein Download-Center an, in dem Berichte zur Nachhaltigkeit sowie Verpflichtungen und Richtlinien verfügbar sind. Diese Dokumente geben Einblicke in die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie und die damit verbundenen Projekte.
- EnBW berichtet über seine Nachhaltigkeitsaktivitäten und misst die Erreichung ihrer Ziele anhand von sog. Top-Leistungskennzahlen.
Informationen zur Strategieumsetzung und zum Projektmanagement sind bisher allgemein gehalten. Es überwiegen Formulierungen wie: Effizienzsteigerungen, verstärkter Einsatz erneuerbarer Energien und Optimierung interner Prozesse.
Berichterstattung und Transparenz
Inhaltlich geht es um
- die Nachhaltigkeitsberichterstattung: Erstellung eines klaren und nachvollziehbaren Berichtsaufbaus, Orientierung an internationalen Standards und Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben. Implementierung von Systemen zur Datenerhebung, -analyse und -validierung, sowie Sicherstellung der Datenqualität und -konsistenz.
- die wesentlichen KPIs: Indikatoren, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) abdecken, Vergleich mit branchenspezifischen Benchmarks und Best Practices, und Einsatz digitaler Tools und Dashboards zur kontinuierlichen Überwachung der KPIs.
- Transparenz. Offenlegung detaillierter und nachvollziehbarer Daten und Informationen zu Nachhaltigkeitsleistungen und -herausforderungen in regelmäßigen Abständen, Sicherstellung, dass die Berichte für alle Stakeholder verständlich und zugänglich sind, sowie Sicherstellung der Berichtsvalidität durch externe Prüfungen oder Zertifizierungen.
Die Berichterstattung hilft dabei, die Fortschritte und Herausforderungen auf dem Weg zu nachhaltigem Wirtschaften zu dokumentieren und für alle Interessengruppen transparent zu machen. Der zu erstellende Nachhaltigkeitsbericht – dieser hat eine fest vorgegebene Struktur mit vier Kapiteln – wird zum integrierten Bestandteil des Lageberichtes.
Praxisbeispiele:
- EnBW misst die Ziele anhand von Top-Leistungskennzahlen, wie z.B.:
- Strategie: Anteil am Adjusted EBITDA gesamt;
- Umwelt: Installierte Leistung Erneuerbare Energien (EE), Anteil EE an der Erzeugungskapazität, CO2-Intensität;
- Mitarbeiter: People Engagement Index, LTIF: Lost Time Incident Frequency (Unfallhäufigkeitsrate)
- MVV Energie hat die Fachbereiche dazu angehalten, die vereinbarten KPIs fortlaufend zu überprüfen und zu bewerten. Zu den Nachhaltigkeitsindikatoren gehören die direkten und indirekten CO2-Emissionen, die Stromerzeugungskapazität bei erneuerbaren Energien, die grüne Wärmeerzeugungskapazität, sowie die Unfallhäufigkeitsrate (LTIF).
- Axpo Holding veröffentlicht detaillierte KPI- und Offenlegungsberichte. Diese enthalten u.a. Angaben zu Treibhausgasemissionen nach Scope und Region, angefallener Abfall nach Produktionsstandorten, sowie KPIs zu Diversität.
Allgemein stehen folgende KPIs in den Berichten der EVUs im Fokus:
- Umwelt-KPIs: CO2-Emissionen, Energieverbrauch, Wasserverbrauch, Abfallmenge und Recyclingquoten.
- Soziale KPIs: Mitarbeiterzufriedenheit, Diversität und Inklusion, Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz / LTIF, Weiterbildung und gesellschaftliches Engagement.
- Wirtschaftliche KPIs: Nachhaltige Investitionen, Kostenreduktionen durch Nachhaltigkeitsmaßnahmen und langfristige wirtschaftliche Vorteile.
Halten wir fest:
Die Nachhaltigkeitsberichte der Energieversorger weisen mehrere wichtige Gemeinsamkeiten auf:
- Strategische Ausrichtung: Alle EVUs analysieren ihr Unternehmensumfeld und definieren ihre Nachhaltigkeitsstrategie im Kontext von Klimazielen (z. B. Pariser Abkommen) und regulatorischen Anforderungen (z. B. EU-Taxonomie, CSRD). Die Durchführung von Wesentlichkeitsanalysen, um die wichtigsten Nachhaltigkeitsthemen zu priorisieren, gehört zum Standard. Häufige Themen sind Klimaschutz, Energieversorgungssicherheit und soziale Verantwortung.
- Nachhaltigkeitsstrategien: EVUs forcieren den Ausbau erneuerbarer Energien (Wind, Solar, Wasserkraft), fördern Energieeffizienz und Dekarbonisierung und legen ihren Fokus auf Innovationen wie Wasserstofftechnologien und Speicherlösungen.
- Umsetzung der Strategien: Die überwiegende Mehrheit der EVUs hat Projekte mit konkreten Meilensteinen, oft in Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen Partnern, gestartet. Die Integration von Nachhaltigkeit in das operative Geschäft und Projektmanagement ist vielerorts erkennbar.
- Key Performance Indicators (KPIs): KPIs haben den Sinn, Fortschritte bei der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen zu evaluieren und transparent zu berichten. Die Nutzung von KPIs, wie CO2-Emissionen, Anteil erneuerbarer Energien, Energieeffizienzsteigerungen und soziale Kennzahlen, in diesem Sinn befindet sich noch am Anfang.
- Berichterstattung: EVUs integrieren ihre Nachhaltigkeitsberichte in ihre Geschäftsberichte. Dies ermöglicht eine ganzheitliche Darstellung der Unternehmensleistungen und deren Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft. Die Unternehmen orientieren sich dabei an internationalen Standards und üben sich in der Transparenz durch die Veröffentlichung von Fortschritten und Herausforderungen. Viele Berichte heben die Bedeutung von Stakeholder-Dialogen hervor, um wesentliche Themen zu identifizieren und die Berichterstattung darauf auszurichten.
Bzgl. der drei Leitfragen dieses Beitrages kann festgehalten werden: Die EVUs haben den notwendigen Wandel erkannt und strategische Überlegungen angestellt. Alle teilen eine klare Ausrichtung auf Klimaneutralität, die Förderung erneuerbarer Energien und die Einhaltung regulatorischer Standards. Ein Masterplan ist unterschiedlich gut erkennbar. EnBW möchte ich als Positivbeispiel hervorheben. Die Berichterstattung von EVUs ist zunehmend transparent und datenbasiert, teilweise aber auch noch deutlich steigerungsfähig.

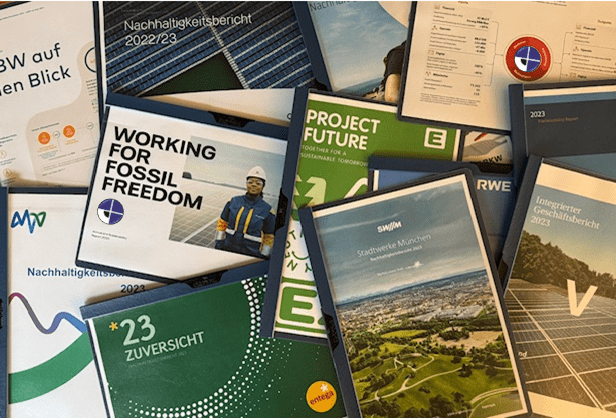
Hinterlasse einen Kommentar